Wer einen Blick auf die aktuelle Weltrangliste der FIDE (Fédération Internationale des Echecs) wirft, wird sehr schnell der tiefgreifenden Veränderungen gewahr, die sich seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Spitzenschach vollzogen haben: Russland, jahrzehntelang die Hegemonialmacht im Schach, ist in den Top 10 nur mehr mit einem einzigen Spieler vertreten, dem 40jährigen Wladimir Kramnik, Weltmeister der Jahre 2000–2007. Frappierend auch der Generationswechsel. Waren im Jahr 2000 neben 23 Spielern der Altersgruppe 40–49 noch etliche 50jährige, ja selbst der 69 Jahre alte Viktor Korchnoi unter den „Top 100 Players“ vertreten, zählen heute schon die Vierzigjährigen – Veselin Topalov (BG) und Wladimir Kramnik oder gar der 47jährige Viswanathan Anand (IND) zum alten Eisen. Den Takt geben der amtierende, erst 25jährige Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen und die Digital Natives der 89’ Generation vor: die US-Amerikaner Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana und Wesley So; der aktuell auf Rang 3 platzierte Anish Giri, Jahrgang 1994, ein Holländer russisch-nepalesischer Herkunft; Rußlands Jungstar Sergej Karjakin; der blasse Franzose Maxime Vachier-Lagrave, der auf seiner Homepage angibt, bereits seit seinem 4. Lebensjahr mit Schachcomputern zu spielen, und last but not least die Großmeister Liren Ding, Yangyi Yu, Xiangzhi Bu, Yue Wang, Hao Wong, Hua Ni, Yifan Hou und der erst 16jährige Wei Yi – die Vorhut der kommenden Schachgroßmacht China.
Großmeister jüdischer Provenienz sind in der Weltspitze rar geworden: da gibt’s den 33jährigen Levon Aronian, gesponsert vom armenischen Oligarchen Samuel Karapetian, der auch das nächste Kandidatenturnier zur Ermittlung des WM-Herausforderers in Moskau finanziert, den 7fachen russischen Staatsmeister Pjotr Svidler auf Platz 17 und den unverwüstlichen, aus Weißrussland stammenden Boris Gelfand (Platz 21), der jetzt für Israel spielt.
Der Glanz früherer Zeiten ist vorbei. Wo sind die Großmeister von der Klasse eines David Bronstein, Isaac Boleslavsy, Reuben Fine, Efim Geller oder Miguel Najdorf? Wo ein Michail Botwinnik, Architekt der „Sowjetischen Schachschule”, der gleich drei Mal den Titel Weltmeister errang? Ein Wassili Smyslow, der – undenkbar heute – Weltmeister wurde und gleichzeitig als Opernsänger reüssierte? Oder ein Michail Tal, aus Riga, den die Schachwelt als „Mozart des Schachs“ verehrte? Ganz zu schweigen von Ausnahmekönnern wie Bobby Fischer, Inkarnation von Genie und Wahnsinn, der zum WM-Duell gegen Boris Spaßig 1972 in Reykjavik erst antrat, als ihn Henry Kissinger („Amerika will, dass Sie hinfliegen und den Russen besiegen!“) darum bat oder Botwinniks Lieblingsschüler Garri Kasparow, der eigentlich Garik Weinstein hieß, der beste Schachspieler aller Zeiten. Und ob sie nun gläubig waren oder Agnostiker, Kommunisten oder Anti-Kommunisten, eine jüdische Mutter oder „nur“ einen jüdischen Vater hatten, eines haben sie alle gemein – die Schachwelt weint ihnen bis heute nach.
Noch wehmütiger blickt der Schach-Nostalgiker freilich auf die Zunft der Berufsschachspieler der belle Epoche zurück, jene meist jüdischen „Weltschachspieler“ aus Ost- und Mitteleuropa, die im Wiener Café Central, in Simpson’s Divan in Central London oder im Pariser Café de la Regence eine zweite Heimat gefunden hatten.
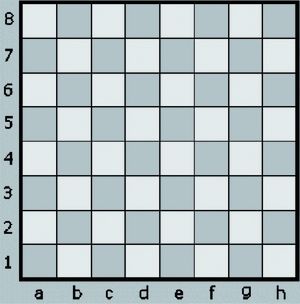 Einer dieser „Weltschachspieler“, die von Turnier zu Turnier, von Wettkampf zu Wettkampf tingelten, um ein oft karges Preisgeld, einen Gratisaufenthalt in irgendeinem Kurhotel oder den „Schönheitspreis für die beste Partie“ einzuheimsen, war der kleingewachsene, stets ein wenig kränkelnde und wegen eines angeborenen Klumpfußes gehbehinderte Wilhelm Steinitz.
Einer dieser „Weltschachspieler“, die von Turnier zu Turnier, von Wettkampf zu Wettkampf tingelten, um ein oft karges Preisgeld, einen Gratisaufenthalt in irgendeinem Kurhotel oder den „Schönheitspreis für die beste Partie“ einzuheimsen, war der kleingewachsene, stets ein wenig kränkelnde und wegen eines angeborenen Klumpfußes gehbehinderte Wilhelm Steinitz.
Am 14. Mai 1836 als neuntes von 13 Kindern des Schneiders Josef Salamon Steinitz und dessen Frau Anna in der Prager Judenstadt geboren, wuchs er in tristesten Verhältnissen auf. In der Goldrichgasse, wo die Steinitz wohnten, einer stickigen Sackgasse hin zur Ghettomauer, war auch der Tod zu Hause: sechs seiner Geschwister starben noch vor Erreichung des achten Lebensjahres, davon zwei im Säuglingsalter. Und als Wilhelm neun Jahre alt war, starb auch die Mutter...
Wie das in London erscheinende Magazin The Jewish Chronicle in einem noch zu Lebzeiten von Steinitz erschienen Artikel berichtet, stach Wilhelm jedoch schon im Alter von 13 Jahren wegen seiner ausgezeichneten Talmudkenntnisse hervor, und ein Rabbi wird es wohl auch gewesen sein, der ihn in die Geheimnisse des königlichen Spiels einführte. Schon als Jugendlicher tauchte er jedenfalls regelmäßig in Prags Kaffeehäusern auf, um mit Schach ein paar Kreuzer zu verdienen.
Ende 1858 zog es ihn dann nach Wien. Er wollte Mathematik studieren, versuchte sich auch als Journalist, entdeckte aber schon bald, am ehesten noch als Schachspieler überleben zu können. In den eleganten Kaffeehäusern der Wiener Innenstadt war der hinkende Habenichts im abgerissenen Überzieher aber nicht unbedingt willkommen.
„Jo, kennan’s denn überhaupt Schach spiel’n?“, fragte ihn einem immer wieder kolportierten Ondit zufolge Major Ritter von Haymmerle, Präsident des noblen, damals im Café Rebhuhn beheimateten Wiener Schachvereins, als Steinitz, um Einlass bittend, wieder einmal vor der gläsernen Eingangstür zum Schachzimmer stand.
„O ja, sogar blind!“ antwortete dieser.
„Blind?“ Der Herr Major wurde hellhörig – und hieß ihn, „blind“, sprich, ohne ein Schachbrett vor Augen, gegen zwei ausgekochte Vereinsspieler antreten.
Lesen Sie mehr in der Printausgabe